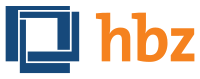|
|
| Titel | Auftreten, Charakterisierung und Kontrolle des Erregers der Rübenfäule, Rhizoctonia solani, in Nordrhein-Westfalen |
| Verantwortlich | Verfasser Irene Zens, Ulrike Steiner, Heinz-W. Dehne ; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Landwirtschaftliche Fakultät Lehr- und Forschungsschwerpunkt "Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft" |
| Autor/in |
Zens, Irene
|
Steiner, Ulrike
|
Dehne, Heinz-Wilhelm
|
| Herausgeber/in |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Lehr- und Forschungsschwerpunkt Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft
|
| Medientyp | Online |
| Publikationstyp | Buch |
|
Erschienen
|
2002
Bonn
Lehr- und Forschungsschwerpunkt "Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft", Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
|
| Inhalt | ger: Die späte Rübenfäule ist eine Krankheit, die zunächst als regional verstärkt in Nordrhein-Westfalen auftretendes, inzwischen aber als bundesweites Problem erkannt wurde. Zunehmend wurde in den vergangenen Jahren von großflächigen Pflanzenausfällen berichtet. Rhizoctonia solani, der Erreger der Rübenfäule, ist ein weltweit vorkommendes und extrem vielfältiges Pathogen, das in zahlreichen Biotypen auftritt. Der Erreger wurde der Anastomosegruppe AG 2-2 zugeordnet. Diese konnte auch schon im frühen Wachstumsstadium der Zuckerrübe isoliert werden. Die Anastomosegruppe gibt in einem gewissen Umfang Auskunft über den Wirtspflanzenkreis des Pathogen. Ein typisches Pathogen an der Kartoffel ist beispielsweise die AG 3. Bei dem Erreger von Keimlingsfäulen handelt es sich meist um die AG 4. Das Rübenpathogen AG 2-2 kann unterteilt werden in die AG 2-2IIIB, ein ́Gramineen-Pathogen ́, und die AG 2-2IV, aus der Literatur bekannt als ́Chenopodiaceen-Typ ́. Die Untersuchung des in Deutschland vorkommenden Fäuleerregers mittels RAPD-PCR ergab, daß dieser nochmals in weitere Untergruppen unterteilt werden kann. Davon konnte die Mehrzahl dem ́Gramineen-Pathogen ́ zugeordnet werden. Das ́Zuckerrüben-Pathogen ́ wurde in stark betroffenen Befallsgebieten weniger häufig isoliert. Unterstützt wurde die Bedeutung des Vorkommens unterschiedlicher Typen durch deren biologische Eigenschaften. Sie unterschieden sich nicht nur in ihrer Temperaturtoleranz, sondern auch Fungizidsensitivität und insbesondere in ihrer Virulenz. Der Typ 4 reagierte sehr tolerant auf hohe Temperaturen und sensitiver auf Fungizide. Auch nach Anwendung des Wirkstoffes Pencycuron, dessen Effekt gegenüber unterschiedlichen Anastomosegruppen von ́nicht ́ bis hin zu ́sehr gut wirksam ́ reicht, konnte eine Differenzierung der Typen beobachtet werden. Auf einer einzelnen Befallsfläche wurde trotz räumlich entfernter ... |
| Umfang | 1 Online-Ressource (IV, 99 Seiten) : Illustrationen, Diagramme |
| Erschienen als | Forschungsbericht / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, Landwirtschaftliche Fakultät, Lehr- und Forschungsschwerpunkt "Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft", Band 91 |
| Parallelausgabe |
CD-ROM-Ausgabe |
|
| Raumsystematik |
01 Nordrhein-Westfalen
|
|
| Sachsystematik |
544220 Ackerbau
|
|
| Schlagwörter |
Nordrhein-Westfalen
|
Rübenanbau
|
Rhizoctonia solani
| 2
|